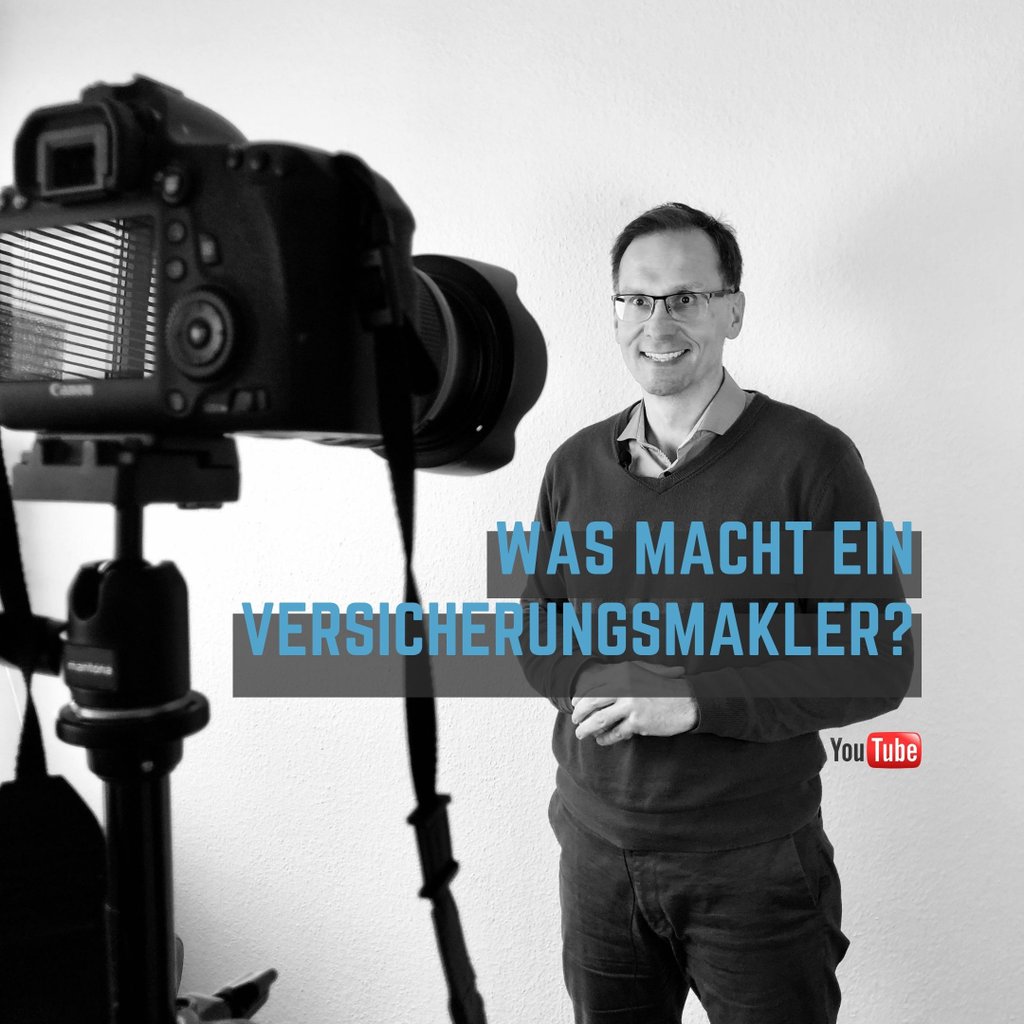💡 Produkthaftung – ein Thema, das viele unterschätzen.
Was passiert, wenn dein Produkt versagt – und der Schaden im Ausland eintritt?
Wer zahlt, wenn dein Versicherer die Deckung verweigert, weil plötzlich österreichisches Recht gilt?
Ich erkläre in meinem Beitrag:
✔️ welches Recht bei grenzüberschreitender Produkthaftung gilt
✔️ was eine Rechtswahl bedeutet – und wann sie gefährlich wird
✔️ worauf Hersteller in der Life-Science-Branche achten sollten, um Deckungslücken zu vermeiden
📄 Jetzt lesen & teilen – für alle, die mit Medizinprodukten, Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmitteln international unterwegs sind.
Rechtswahl in der Produkthaftung
In einem Streitfall hat der Bundesgerichtshof (BGH VI ZR 82/22) folgende Feststellung getroffen:
„Wird in Produkthaftungsfällen eine ausdrückliche Rechtswahl zugunsten deutschen Rechts getroffen, kann diese auf Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.07.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-VO) oder auf Art. 42 EGBGB beruhen.“
Das deutsche Gericht musste sich mit der Klage einer deutschen Patientin befassen, die gegen eine Herstellerfirma mit Sitz in Österreich eingereicht worden war. Es ging darum, ob das Medizinprodukt einen Produktfehler hatte, als es im August 2007 implantiert und damit in Verkehr gebracht wurde. Das Implantat brach und musste im Juli 2011 ausgewechselt werden.
Der gesundheitliche Leidensweg dauerte rund vier Jahre, der Rechtsweg durch die Instanzen sogar zwölf Jahre!
Das Urteil wirft folgende Fragen auf:
- Welches Recht gilt „eigentlich“ heute bei Produkthaftungsfällen, wenn der Geschädigte und der Schädiger nicht im gleichen EU-Land ansässig sind?
- Welches Recht gilt bei Produkthaftungsfällen, wenn der Geschädigte ein Verbraucher ist?
Welches Recht gilt bei europäischen Produkthaftungsfällen?
Die gerichtliche Zuständigkeit für Produkthaftpflichtschäden, deren Verfahren ab dem 10. Januar 2015 eingeleitet wurden, regelt die sogenannte Brüssel Ia-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012). Im Grundsatz gilt, dass Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU vor den Gerichten dieses Mitgliedstaats verklagt werden müssen.
Es gibt jedoch zahlreiche Abweichungen. Unternehmen können auch in einem anderen Mitgliedstaat verklagt werden, insbesondere:
- Vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder hätte erfüllt werden müssen, wenn vertragliche, kaufrechtliche Haftungsansprüche den Gegenstand des Verfahrens bilden.
Beispiel: Gewährleistungshaftung für zugesicherte Eigenschaften einer Rohstoff-Lieferung. - Vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht, wenn deliktische Produkthaftungsansprüche oder die deliktische Herstellerhaftung den Gegenstand des Verfahrens bilden.
Beispiel: Produkthaftung durch das Inverkehrbringen von Kosmetika für Konsumenten oder Herstellerhaftung für Schäden durch unsichere Produkte. - Vor dem ausländischen Gericht, wenn es sich z. B. um Produkthaftungsfälle aus dem Lebensmittel-, Kosmetik- oder Medizinproduktebereich handelt, die gleichzeitig strafrechtlich relevant sind, z. B. wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Beispiel: Deliktshaftung für Schäden durch ungenießbare Lebensmittel, die nachweislich Personenschäden verursacht haben. - Vor dem Gericht des Ortes, aus dem ein Betrieb, eine Zweigniederlassung oder sonstige Niederlassung wie z. B. ein Vertriebsbüro oder Lager erfolgt.
Welches Recht gilt bei Produkthaftungsfällen, wenn der Geschädigte ein Verbraucher ist?
Sollte ein Verbraucher einen Produkthaftpflichtschaden erleiden, richtet sich sein Recht zur Wahl des Gerichtsstandes nach den Regelungen zum Verbrauchergerichtsstand gemäß Art. 18 ff. Brüssel Ia-VO. Diese Vorschriften gelten allerdings nur bei vertraglichen Streitigkeiten und nicht automatisch bei Produkthaftungsfällen, die in der Regel deliktischer Natur sind.
Produkthaftungsansprüche können sich aus verschiedenen Rechtsgrundlagen ergeben – insbesondere aus dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), welches die EU-Produkthaftungsrichtlinie 85/374/EWG in deutsches Recht umsetzt, sowie aus § 823 BGB (deliktische Herstellerhaftung).
Erhebt ein Verbraucher eine Klage nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) gegen ein Unternehmen, kann er aus einer Reihe von Gerichtsständen frei wählen.
- Gerichte am Sitz des Unternehmens das verklagt werden soll
- Gerichte am Wohnsitz des Verbrauchers
- Gerichte des Ortes an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht
Der einfachste Weg für einen Verbraucher, so scheint es, dürfte der Aktivgerichtsstand an seinem Wohnort sein. Dort kann er Klage gegen den Unternehmer erheben. Die Wahl eines anderen Gerichtsstandes kann ebenfalls schlau sein.
Das gilt mittlerweile auch für Ansprüche gegen ein Unternehmen, das seinen Sitz außerhalb der EU hat. Praktisch ist das relevant, falls das Unternehmen über vollstreckbares Vermögen verfügt auf das man innerhalb der EU oder in einem Abkommenstaat zugreifen kann.
Art. 14 Rom II erlaubt den Parteien auch in außervertraglichen Schuldverhältnissen – wie etwa Produkthaftung – eine ausdrückliche Rechtswahl. Dies erfolgt häufig durch vertragliche Vereinbarungen oder AGB.
Welche Bedeutung hat die Rechtswahl für Deine Produkthaftpflichtversicherung – worauf musst Du achten?
Wenn Du Hersteller oder Inverkehrbringer von Medizinprodukten, Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmitteln bist, dann entscheidet die Rechtswahl im Haftungsfall oft darüber, ob Dein Versicherungsschutz greift – oder nicht.
Denn: Produkthaftpflichtversicherungen enthalten in der Regel Deckungsausschlüsse für bestimmte Rechtsräume oder knüpfen an bestimmte nationale Haftungsnormen an. Eine bewusste oder unbewusste Rechtswahl, z. B. durch AGB, Rahmenverträge oder Vertriebsvereinbarungen kann dazu führen, dass:
– Du plötzlich nach einem ausländischen Haftungsrecht haftest, z. B. österreichisches Produkthaftungsgesetz statt deutschem ProdHaftG,
– Deine Versicherung Leistung verweigert, weil das gewählte Recht außerhalb des vereinbarten Deckungsgebiets liegt,
– oder Deckungslücken entstehen, z. B. bei Strafverfahren im Ausland wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Worauf solltest Du achten?
✅ Prüfe mit Deinem Versicherungsmakler, welche Deckungsräume und Rechtsordnungen deine Police tatsächlich abdeckt.
✅ Achte bei internationalen Verträgen auf Rechtswahlklauseln – besonders bei Distributoren oder bei klinischen Prüfungen.
✅ Lass AGB und Verträge regelmäßig rechtlich und versicherungstechnisch prüfen, bevor du neue Märkte betrittst.
Mein Fazit:
Die Rechtswahl ist kein rein juristisches Thema – sie kann im Ernstfall über das finanzielle Überleben entscheiden. Wer international tätig ist, sollte seine Versicherungskonditionen mit der Rechtswirklichkeit seiner Lieferkette abgleichen.
Sie suchen eine individuelle Versicherungslösung für Ihr Unternehmen?
Wedel, 02.05.2025, Diplom-Kaufmann Christian Fuchs ist der „Versicherungs-Fuchs“ für Produkthaftpflichtversicherungen und staatlich geprüfter Haftpflicht-Underwriter (DVA)
Folgende Artikel könnten für Dich interessant sein:
Die neue Produkthaftungsrichtline der EU-Kommission hat es in sich – schärfer, komplexer, teurer